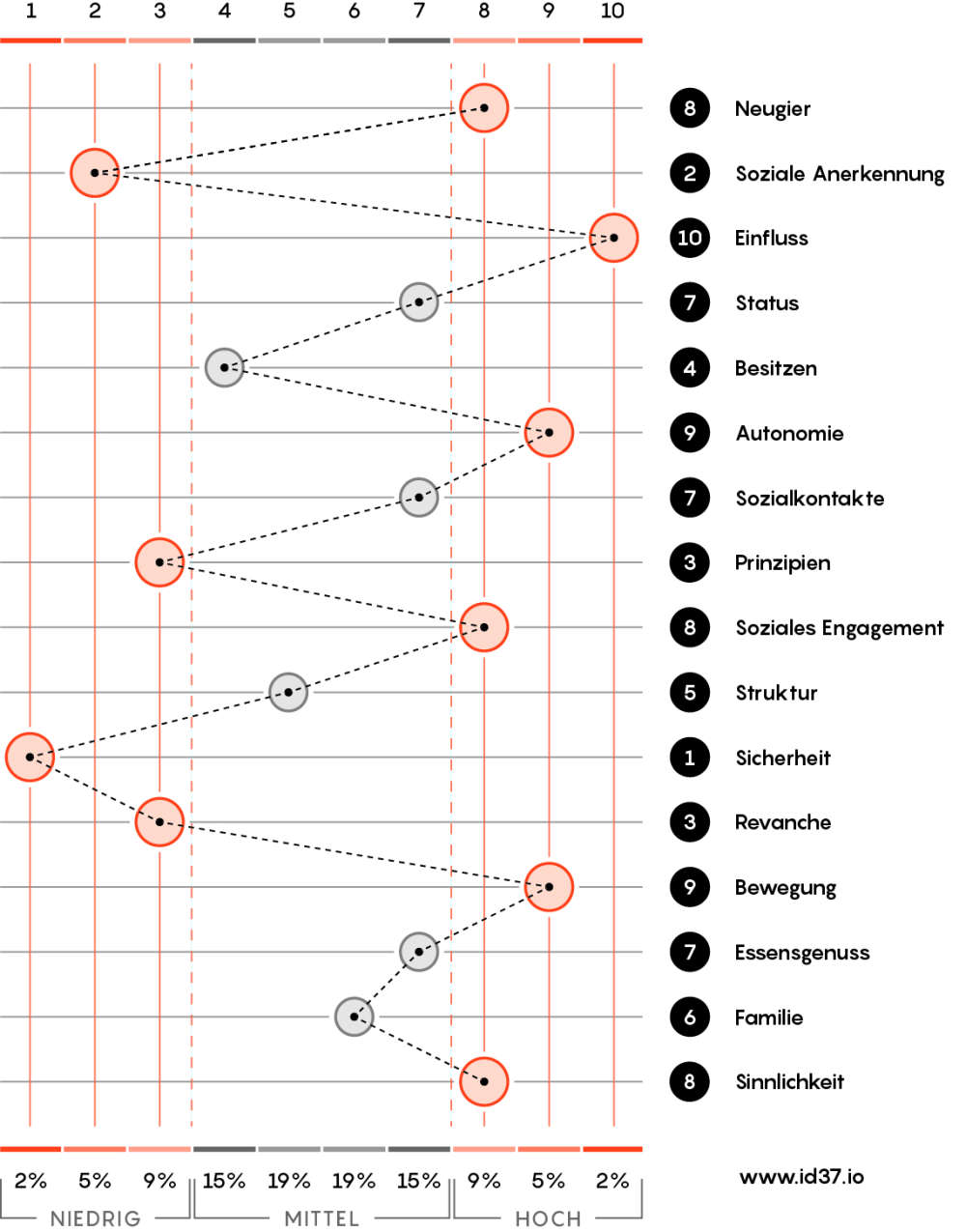Richtig eingesetzt, ist die Anwendung von eignungsdiagnostischen Verfahren in der Personalauswahl und -entwicklung nicht nur fortschrittlich, sondern auch besonders kosten- und zeitsparend. In der Praxis zeigt sich allerdings häufig, dass die angewandten Verfahren das eigentliche Messziel – Ihr individuelles Anforderungsprofil – verfehlen und stattdessen globale, unspezifische Merkmale messen. Um von den Vorteilen der beruflichen Diagnostik zu profitieren und genau jene Merkmale zu erfassen, die für den Erfolg entscheidend sind, empfiehlt sich die Messung spezifischer beruflicher Kompetenzen, die feingliedrig sämtliche Anforderungsprofile abbilden können und nicht "den einen" Berufserfolg definieren. Wie Sie Ihre spezifischen Anforderungen übersetzt in Kompetenzen einfach messen können, verrät Ihnen dieser Artikel.
Warum Praxis eine Frage der Wissenschaft ist
„Gute Verfahren unterstützen Sie dabei, sowohl die Passung der Person für die Stelle als auch die Passung der Stelle für die Person sicherzustellen.“
Sie stehen mit Ihrem Unternehmen vor der Personalauswahl und wissen nicht, welches Verfahren Sie anwenden sollen? Den ersten Schritt in die richtige Richtung haben Sie schon getan, indem Sie sich diese Frage stellen. Denn die Verwendung von eignungsdiagnostischen Verfahren, die auf dem aktuellen Stand der Forschung sind, rentiert sich gegenüber unwissenschaftlichen, subjektiven und teuren Bewerbungsprozessen. Eben solche können einen großen Kostenfaktor für Ihr Unternehmen darstellen, wenn sich vermeintlich geeignete Bewerber*innen als ungeeignet herausstellen oder geeignete Personen nicht erkannt und abgelehnt werden und damit an die Konkurrenz verloren gehen. Gute Verfahren unterstützen Sie dabei, sowohl die Passung der Person für die Stelle als auch die Passung der Stelle für die Person sicherzustellen. Passen die Qualifikationen einer Person zu den Anforderungen der Stelle, kann sie eine bessere Arbeitsleistung zeigen. Wenn auch die Stelle zur Person passt, also ihre persönlichen Bedürfnisse und Motive anspricht und erfüllt, steigt die Arbeitszufriedenheit, die wiederum ein wichtiger Einflussfaktor auf die Bindung der Person an die Organisation ist (Nerdinger, Blickle & Schaper, 2008). So kann Fluktuation aufgrund von schlechter Arbeitsleistung oder Unzufriedenheit der Mitarbeiter vermieden werden.
Was ein gutes Verfahren ausmacht
Allerdings gibt es eine Unmenge an Verfahren, die auf dem Markt als erfolgsversprechend angeboten werden. Doch leider kann der Schein trügen. Woran können Sie nun ein gutes Verfahren erkennen? Anfänglich sollten Sie auf die wissenschaftliche Fundierung und die Erfüllung der Gütekriterien bei der Auswahl achten. Um aber größtmöglich von dem Einsatz des Verfahrens profitieren zu können, sollten Sie sich auch die Frage stellen: „Was möchte ich eigentlich messen?“. Zwar könnten Sie beispielsweise einen Intelligenztest durchführen, der ein guter Prädiktor für die globale Arbeitsleistung ist, allerdings werden Sie so vermutlich nicht den spezifischen Anforderungen der zu besetzenden Stelle gerecht.
Das Ergebnis langjähriger Forschung
Daher ist es ratsam, die jeweiligen Anforderungen zu definieren, indem man die Arbeitsleistung als Kriterium weiter ausdifferenziert betrachtet. Dies war auch der Ansatz einer Metaanalyse von Kurz und Bartram (2002). Eine Metaanalyse ist eine Zusammenfassung mehrerer Einzelstudien mit dem Ziel, ein Forschungsthema übersichtlich abzubilden. Dabei versucht man, Widersprüchlichkeiten zu identifizieren und Konsens in der Wissenschaft zu schaffen. In vorherigen Studien wurde oftmals die globale Arbeitsleistung als Kriterium erfasst, obwohl sich die Wichtigkeit verschiedener Aspekte der Arbeitsleistung zwischen verschiedenen Berufen und Branchen unterscheidet. Daher haben Kurz und Bartram die Ergebnisse von 29 Studien zusammengefasst, in denen Führungskräfte spezifische Kompetenzen als Kriterium für Berufserfolg bewerteten. Daraus ergab sich ein generisches Kompetenzrahmenmodell, die Great Eight, die die Basis für eine differenziertere Messung der Arbeitsleistung bilden. Sie konnten unter anderem von Kurz et al. (2004) repliziert werden und besetzen daher eine starke Position innerhalb der Domäne der Arbeitsleistungsbeurteilung.
Berufliche Kompetenzen „werden als das momentane Ergebnis individueller Lernprozesse verstanden, welche durch Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Persönlichkeit und Interessen beeinflusst sind.“ (Ziegler, 2016)
Aufgrund des Zusammenspiels dieser Aspekte integriert die Messung der Kompetenzen zahlreiche Informationen und stützt sich daher zum Beispiel nicht nur auf die Intelligenz, wodurch die Vorhersagekraft ansteigt.
Wie können Sie diese Studienerkenntnis in Ihrer Verfahrensauswahl berücksichtigen?
Sie sollten klar bestimmen, welche Kompetenzen relevant für die zu besetzende Stelle sind. Anschließend können Sie diese Kompetenzen im Auswahlprozess prüfen und die Kompetenzprofile der Bewerber*innen mit dem vorher erstellten Anforderungsprofil abgleichen. Da die Great Eight allerdings zu breit angelegt sind, um der Heterogenität der Anforderungen unterschiedlichster Stellen gerecht zu werden, wurde eine weitere Ausdifferenzierung von Bartram in einem Übersichtsartikel (2005) empfohlen.
Der Great-8-Tachometer – 39 Kompetenzbereiche in einem Verfahren
Dieser Ansatz wurde bei der Entwicklung des Great-8-Tachometer, kurz G8T (Ziegler & May, 2016) verfolgt, indem die Great Eight in 39 Kompetenzbereiche aufgegliedert wurden. Somit ist eine feingliedrige Abbildung unterschiedlichster Ansprüche an Kompetenzen für den beruflichen Kontext im G8T möglich. Das bietet Ihnen die Gelegenheit, ein ausführliches Anforderungsprofil zu erstellen, welches Ihren spezifischen, individuellen Anforderungen entspricht. Die Bewerber*innen können daraufhin einen ca. 30-minütigen computerbasierten Fragebogen ausfüllen, der ihre Kompetenzen im Selbstbild erfasst. Um diese gewonnenen Daten durch Ihre erfahrungsgestützte Einschätzung zu ergänzen, haben Sie die Möglichkeit, einen speziell auf den G8T abgestimmten Interviewleitfaden einzusetzen. Dadurch wird Ihnen die strukturierte Erfassung eines Fremdbildes der Bewerber*innen ermöglicht. Denn sowohl die Eigen- als auch die Fremdperspektive tragen zur Vorhersage von Leistung bei (Ziegler, Danay, Schölmerich & Bühner, 2010). Allerdings zeigt die psychologische Forschung, dass Selbst- und Fremdberichte nur selten übereinstimmen (Connelly & Ones, 2010), was an den unterschiedlichen Perspektiven der Rater auf die Person liegt (McAbee & Connelly, 2016). Daher können Sie sich vorab überlegen, welche Ausprägung eines Kompetenzbereichs Sie aus Sicht eines Fremdraters voraussetzen und so Ihr Interview planen. Nach erfolgter Datenerhebung wird im Vergleich mit dem Anforderungsprofil die am besten geeignetste Person auswählt. So erleichtert Ihnen der G8T den Personalauswahlprozess und sichert die Eignung der ausgewählten Person durch die Beachtung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Fokussierung auf Ihr konkretes Messziel. Darüber hinaus lässt sich der G8T nicht nur in der Personalauswahl einsetzen, sondern unterstützt auch bei der Personal- und Organisationsentwicklung. Explizite Trainingsmaßnahmen lassen sich demnach genauso leicht ableiten wie Organisationswerte und -visionen. Wenn Sie gerne weitere Informationen zum G8T erhalten möchten, können Sie mit The ROC Institute GmbH Kontakt aufnehmen.
Quellen:
Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. Journal of Applied Psychology, 9. 1185.
Connelly, B. S., & Ones, D. S. (2010). An Other Perspective on Personality: Meta-Analytic Integration of Observers’ Accuracy and Predictive Validity. Psychological Bulletin, 136, 1092-1122. doi: 10.1037/a0021212
Kurz, R., & Bartram, D. (2002). Competency and individual performance: Modelling the world of work. Organizational effectiveness: The role of psychology, 227-255.
Kurz, R., Bartram, D., & Baron, H. (2004). Assessing potential and performance at work: The Great Eight competencies. Proceedings of the British Psychological Society Occupational Conference (pp. 91–95). Leicester, UK: British Psychological Society.
McAbee, S. T., & Connelly, B. S. (2016). A multi-rater framework for studying personality: The trait-reputation-identity model. Psychological Review, 123, 569-591. doi: 10.1037/rev0000035
Nerdinger, F., Blickle, G., & Schaper, N. (2008). Arbeits- und Organisationspsychologie. Springer.
Ziegler, M., & May, R. (2016). The Great 8 Tachometer. Berlin: The ROC Institute GmbH.
Ziegler, M., Danay, E., Schölmerich, F., & Bühner, M. (2010). Predicting academic success with the Big 5 rated from different points of view: Self-rated, other rated and faked. European Journal of Personality, 24, 341-355. doi: 10.1002/per.753