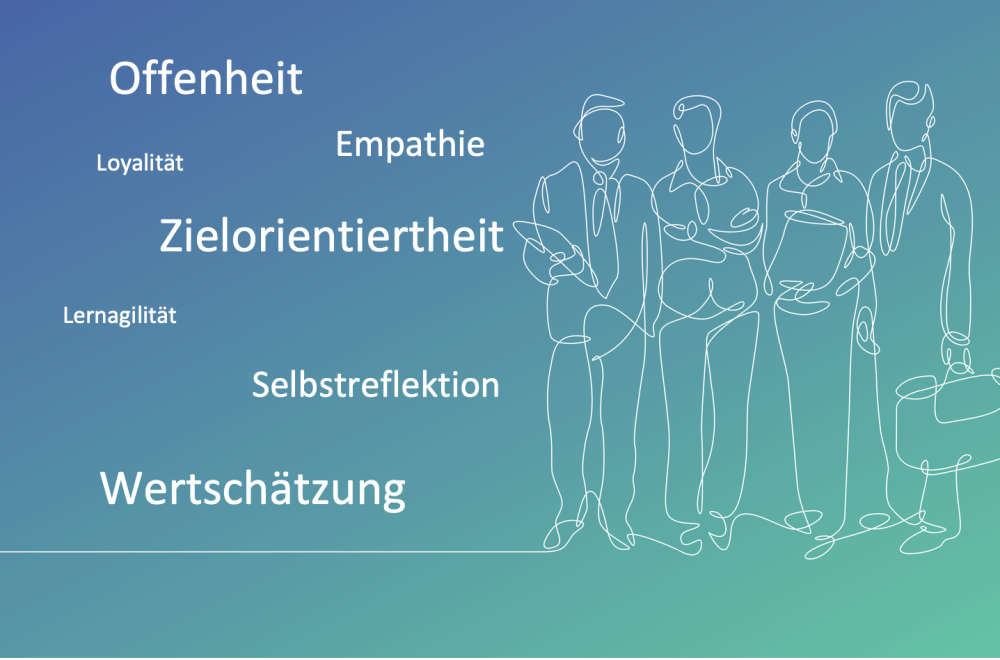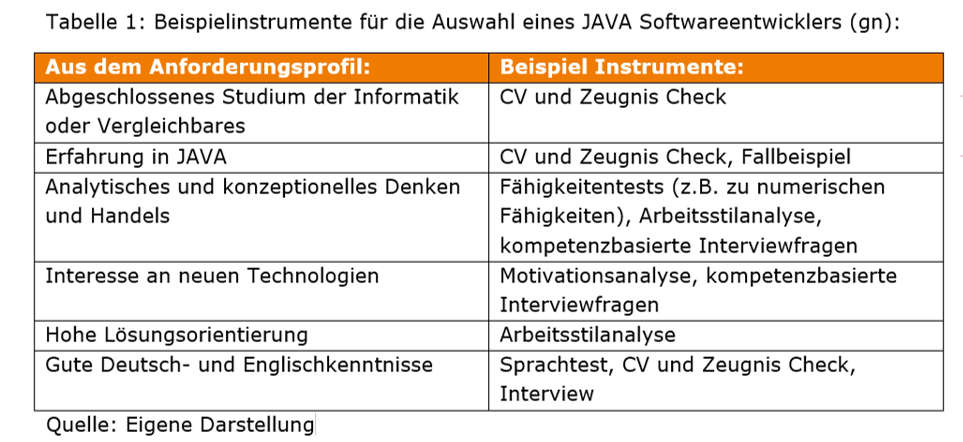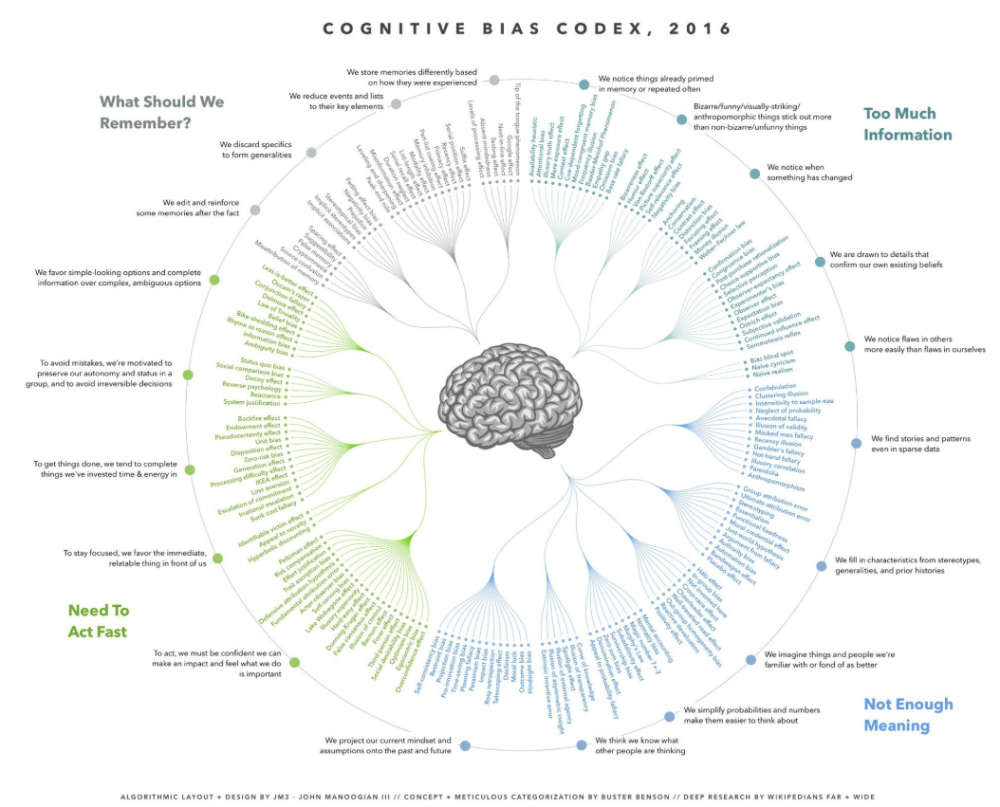Welche Kompetenzen brauchen Führungskräfte im Zuge der Digitalisierung? Sind High-Level-Positionen und Hierarchien durch die digitale Transformation zukünftig überhaupt noch relevant?
Die Digitalisierung kratzt an traditionellen Rollenverteilungen, davon sind auch klassische Führungspositionen betroffen. Wie verändern sich Leadership-Positionen im digitalen Business eigentlich? Das HR-Vergleichsportal PEATS klärt auf.
Die bisherigen Anforderungen an eine Führungskraft schwanken je nach Unternehmen und Aufgabenschwerpunkt. Allerdings lässt sich beim Recruiting von Führungskräften doch ein klares Muster erkennen - zu den Anforderungen zählen hier unter anderem Durchsetzungsfähigkeit, Empathie und ein lösungsorientiertes Arbeiten. Verändern sich diese Anforderungen auf lange Sicht? Die digitale Transformation verändert das HR-Management, aber auch unternehmensweite Arbeitsprozesse und gesamte Abläufe. Es kommt vermehrt zu projektbezogenen Teams, was dazu führt, dass zuvor starre Mitarbeiter- und Tätigkeitsstrukturen aufweichen und flexibler gestaltet werden müssen. Diese Teams brauchen eine andere Art von Führung. Mit genau diesem Thema beschäftigt sich außerdem die aktuelle Studie "Future Hot Skill" der FH Nürnberg.
Wie die Digitalisierung virtuelle und projektbezogene Teams fördert
Digitale Vernetzungsmöglichkeiten (Team-Kommunikation über Messenger-Systeme, Kollaborationen über Clouds und andere digitale Schnittstellen) erlauben es, dass Mitarbeiter sich nicht mehr physisch an einem Ort befinden müssen. Ob die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, sich in unterschiedlichen Niederlassungen befinden oder das Projekt nur mit mehreren Freelancern funktioniert: Die Zusammenarbeit von virtuellen Teams wird immer relevanter und durch digitale Tools und Endgeräte auch technisch umsetzbar.
Der Führungskraft kommt in virtuellen Teams oder Projektgruppen eine neue Rolle zu:
Die beiden wichtigsten Aspekte bei der Zusammenarbeit in virtuellen Teams oder räumlich getrennten Projektgruppen sind Koordination und Kommunikation. Hierfür braucht es klare gemeinsame Regeln, die der Lead einführen und vor allem vorleben muss. Wir vermuten also, dass Flexibilität ebenso wichtig wird als Durchsetzungsvermögen; dass neben Redegabe eine größere Stressresistenz von wachsender Bedeutung ist.
Mitarbeiter, Prozesse und Meetings koordinieren
Um ein virtuelles Team erfolgreich zu organisieren, ist die Koordination aller Prozesse ein relevanter Aspekt. Wichtig ist der regelmäßige Austausch, der trotz unterschiedlicher Orte, Zeitzonen und Kulturen stattfinden muss.
Eine Führungskraft muss koordinieren
- wann und wie oft Telefonkonferenzen oder Skype-Calls stattfinden können,
- inwieweit ein Jour Fixe digital stattfinden kann, wenn die Mitarbeiter in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten,
- wie Arbeitsaufträge und Ergebnisse dokumentiert und zusammengetragen werden, damit alle Teammitglieder daran arbeiten können und auf dem gleichen Stand sind,
- dass eine transparente Kommunikation gewährleistet wird, um Missverständnisse zu vermeiden.
Eine disziplinierte Vor- und Nachbereitung von Meetings kann wichtiger werden als üblich, da aufgrund längerer Kommunikationswege die Mitarbeiter virtueller Teams weniger auf Zuruf arbeiten können.
Transparente Kommunikation schafft Vertrauen
Eine effektive Koordination und die Einführung von Regeln in virtuellen Teams geht einher mit einer erfolgreichen Kommunikation. Führungskräfte übernehmen generell in einem Team die Position einer Schnittstelle. Sie fungieren für Mitarbeiter des Teams als erste Ansprechperson und sorgen für einen idealen Austausch und Prozessabläufe. In virtuellen Teams ist es durchaus möglich, dass sich Kollegen noch nie persönlich getroffen haben oder der Kontakt nur über Dritte funktioniert. Für eine kollegiale Atmosphäre, Teamarbeit und Mitarbeiterzufriedenheit sind das keine guten Voraussetzungen. Die herausfordernde Aufgabe des Leads besteht in dem Moment darin, zwischen verschiedenen Parteien zu vermitteln, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und dadurch ein motivierendes Klima zu schaffen. Missverständnisse und Konflikte gilt es zu vermeiden beziehungsweise transparent zu klären.
Interkulturalität für eine erfolgreiche Kollaboration
In virtuellen Teams ist der Umgang mit Interkulturalität eine wichtige Voraussetzung. Wenn Mitglieder aus unterschiedlichen Nationen zusammen arbeiten, müssen Führungskräfte dafür sorgen, dass kulturelle Unterschiede berücksichtigt und respektiert werden. Kulturelle Interferenzen sind aber nicht bloß in einem internationalen Umfeld ein Thema: Auch unterschiedliche Unternehmenskulturen können Arbeitsprozesse belasten.
Unter alter Technik leiden Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit
Auch wenn virtuelle Teams viel vereinfachen und internationale Teams dadurch näher zusammenrücken, ist eine funktionierende Technik das A und O für diese Art von Kollaboration. Klare Kommunikation, erfolgreiche Koordination und Interkulturalität können auch gegen obsolete Software, nicht kompatible Betriebssysteme oder alte Hardware nichts mehr ausrichten. Spätestens dann, wenn ein Unternehmen flexible Arbeitsprozesse etablieren möchte, braucht es dementsprechende Technik. Aber auch im gängigen Großraumbüro können sich veraltete Computer und Softwarelizenzen negativ auf die Motivation auswirken. Wer projektbezogene und flexible Teams leiten will, muss sich also für eine aktuelle und funktionierende Technik stark machen.
Deutschland beim Thema Digitalisierung nur im Mittelfeld
Deutsche Unternehmen nutzen die Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung entstanden sind, bisher noch zu wenig. Aus einer aktuellen Studie von Cornerstone geht hervor, dass sich Deutschland im europaweiten Vergleich nur im Mittelfeld bewegt. Dies betrifft vor allem flexible Arbeitsmöglichkeiten (Homeoffice, mobile Geräte und ortsunabhängige Apps) und die technische Ausstattung.
Dass Deutschland in vielen Dingen bei der Digitalisierung hinterher hinkt, begründet Geoffroy de Lestrange von Cornerstone in einem Interview 2017 vor allem mit dem demografischen Wandel: In Positionen, in denen relevante Entscheidungen getroffen werden, sitzen vor allem ältere Managerinnen und Manager. (Digitale) Veränderungen werden aber vor allem von jüngeren Beschäftigten angetrieben. Diese Situation lässt sich am besten unter dem Begriff des Kulturellen Widerstands zusammenfassen.
Bild: littlehenrabi, 2017